Den Nebel habe ich immer geliebt. Als Kind erschien es mir aufregend geheimnisvoll, wenn die…
In Geschichten verstrickt: Über Störnarrative, und wie man sie loswird
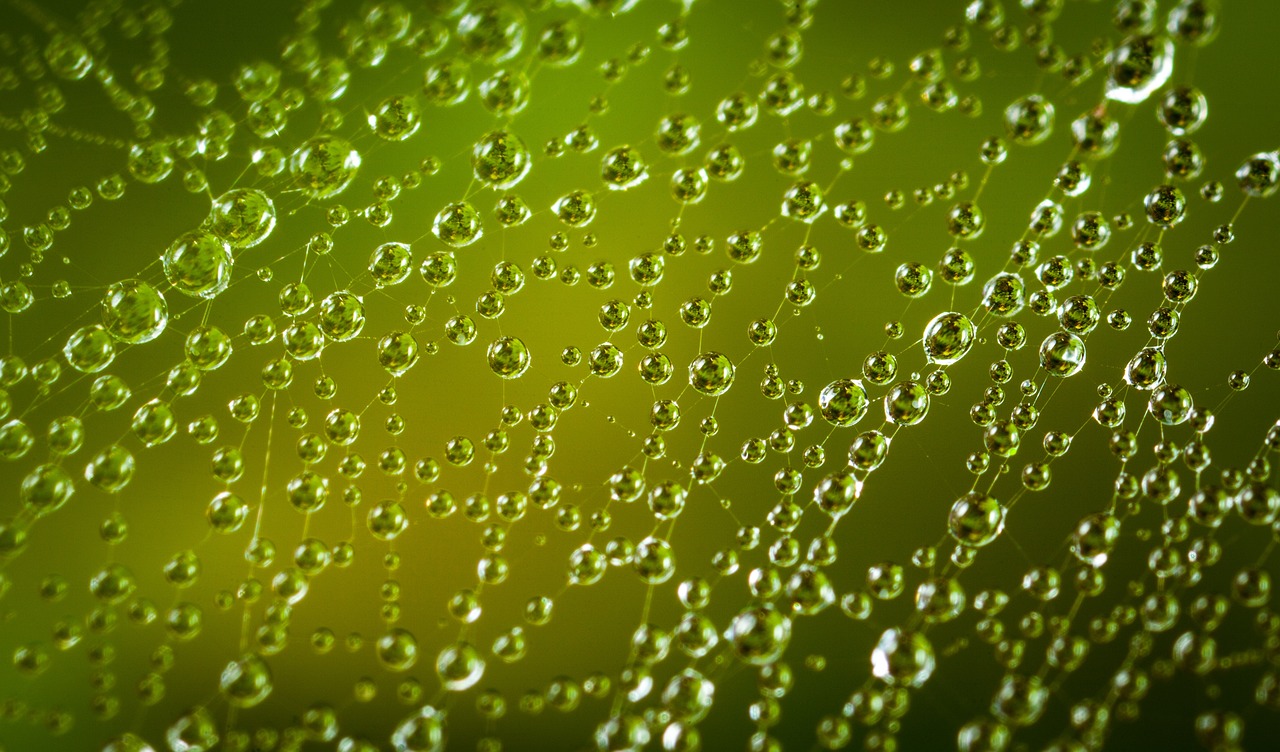
P. erzählt mir in einer Coachingsitzung, dass er große Angst habe vor einer Präsentation, die er in wenigen Wochen vor der Bereichsleitung in seinem Unternehmen halten müsse. Ich habe ihn als einen sehr kompetenten und selbstbewussten Menschen kennen gelernt, deshalb wundere ich mich über die Stärke dieser Angst, die sich in seiner Köperhaltung und Mimik ausdrückt. Ich bitte ihn, von bisherigen Erlebnissen mit Präsentationen oder mit dem Bereichsvorstand zu erzählen. Unter anderem berichtet er von einem Erlebnis in der Oberstufe des Gymnasiums, als er eine wichtige Präsentation halten musste, den Faden verloren habe und mit einem „…oder so“ abgebrochen habe. Blackout im Kopf. Die ganze Klasse habe gelacht, er habe eine schlechte Note bekommen, und das „…oder so!“ sei „…zu einem Art Sprach-Meme in der Klasse geworden, mit dem ich immer wieder verarscht wurde.“ Seitdem steckte die Überzeugung „Ich kann nicht präsentieren“ ganz tief in ihm, auch wenn er im beruflichen Kontext alltägliche Standardpräsentationen ganz gut meisterte. Aber ihm fiel im Erzählen auf, dass es besondere Herausforderungen – wie die Präsentation vor dem Bereichsvorstand – waren, die diese Überzeugung immer in den Vordergrund brachte. Sie war zu einem Störnarrativ geworden, das sein bisheriges schulisches und berufliches Leben begleitet hatte.
Ich glaube, niemand von uns muss allzu lange nachdenken, um ähnliche Störnarrative auch im eigenen Leben identifizieren zu können. Manche von ihnen liegen an der Oberfläche und sind uns sehr bewusst, andere entdecken wir vielleicht nach längerem Überlegen, in einem Gespräch oder in einer Coachingsitzung. Gemeinsam ist ihnen, dass sie unser Leben und unser Arbeiten schwerer machen, als es „eigentlich“ nötig wäre: P. könnte ja die Bereichsleiter-Präsentation auch einfach nur halten, ohne über den steinigen Weg des „Ich-kanns-nicht“-Narrativs zu gehen. Aber natürlich ist das nicht so „einfach“; solche Glaubenssätze sind uns durch unsere Erfahrungen tief eingeprägt – deshalb nennen wir sie auch „Narrative“, weil sie auf immer wiederkehrenden Selbst-Erzählungen dieser Erfahrungen beruhen. Und deshalb kann man sie auch nicht einfach mit einem Federstrich oder einer Willensentscheidung loswerden. Aber man kann mit diesen Störnarrativen arbeiten, sie Schritt für Schritt verändern, sie aufweichen, ihre Elemente verschieben, und sich so nach und nach mehr Freiheit und Leichtigkeit im Denken und Handeln gewinnen. Eine solche Arbeit mit Störnarrativen ist ein Teil dessen, was Christine Erlach und ich „In Aktanz gehen“ nennen.
Wie funktionale Glaubenssätze zu Störnarrativen werden
Doch nicht nur als Individuen sind wir „in Geschichten verstrickt“, wie es der Philosoph Wilhelm Schapp formuliert, in Geschichten, von denen manche funktional sind, weil sie uns helfen, mit unserem Alltag zurechtzukommen, manche aber auch dysfunktional und damit Störnarrative sind. Funktionale Glaubensnarrative können zum Beispiel solche sein, die uns warnen, nicht ständig an die Grenze unserer Überforderung zu gehen – sie schützen und vielleicht davor, in den Burn-out zu gehen. Derartige ursprüngliche funktionale Narrative können jedoch irgendwann auch zu Störnarrativen werden – zum Beispiel wenn sie uns von jeder neuen Herausforderung abhalten und wir uns gar nicht mehr getrauen, etwas auszuprobieren.
In Organisationen und Unternehmen wird die Kultur durch die (funktionalen und dysfunktionalen) Narrative und Geschichten, in die sie verstrickt sind, geprägt. Ein Beispiel für ein Störnarrativ, das die Arbeit in einem Unternehmen sehr stark beeinflusst hat, kann zum Beispiel die durch viele Erfahrungen den Mitarbeitenden eingeprägte Überzeugung sein, dass Projekte in diesem Unternehmen nie zu Ende geführt werden und es deshalb verschwendete Energie sei, sich in einem Projekt zu engagieren. Ein solcher Glaubenssatz ist zunächst ein funktionales Narrativ für die Mitarbeitenden, weil es sie davor schützt, nutzlos Energie in Projekten, die ohnehin zu nichts führen, zu vergeuden. Aber es ist natürlich ein massives Störnarrativ für jede Projektarbeit im Unternehmen.
Gesellschaftliche Störnarrative
Und auch auf gesellschaftlicher Ebene gibt es Narrative, die vielleicht einmal funktional waren, inzwischen jedoch zu Störnarrativen geworden sind: So zum Beispiel das Narrativ vom ewigen Wachstum der Wirtschaft, das angesichts der Umwelt- und Klimakrise an seine Grenzen gekommen ist. Jens Beckert beschreibt in seinem neuen Buch „Verkaufte Zukunft. Warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht“ sehr genau, wie dieses der kapitalistischen Moderne eingeprägte Wachstumsnarrativ, dem wir im Westen auch einen großen Teil unseres Wohlstands verdanken, zu einem Störnarrativ geworden ist, das ernsthafte Anstrengungen zum Klimaschutz torpediert.
Ähnlich wie schon beim Individuum erwähnt, bedarf es auch auf der organisationalen oder gesellschaftlichen Ebene eines Prozesses, um Störnarrative zu verändern oder loszuwerden. Und das sind natürlich äußerst komplexe Prozesse – bisher hat meines Wissens noch niemand eine wirklich funktionierende Idee entwickelt, wie man praktisch von der kapitalistischen Wirtschaftsordnung mit ihrem Wachstumsnarrativ zu einer neuen, ökologischen Lebens- und Wirtschaftsordnung gelangen könnte. Aber unser Überleben wird davon abhängen, ob und wie es uns eines Tages vielleicht doch gelingt.
Mit Störnarrativen zu arbeiten ist eine grundlegende Voraussetzung, um Veränderung überhaupt möglich zu machen – für uns als Einzelpersonen ebenso wir für Organisationen und ganze Gesellschaften. Denn sonst hängen uns die Erfahrungen der Vergangenheit wie ein schlechter Geruch in den Kleidern und verhindern, dass wir offen sind für Neues. Der erste Schritt ist, erst einmal zu erkennen, was uns das Leben und das Arbeiten schwer macht, wo unsere Störnarrative überhaupt liegen. Und dann damit zu arbeiten, indem wir sie analysieren, mit ihnen spielen, sie aufweichen und verändern, bis wir sie zumindest als große Verhinderer losgeworden sind. Der dahintersteckende Glaubenssatz ist vielleicht noch nicht weg, aber vielleicht haben wir einen Pfad daneben vorbei entdeckt, er es uns ermöglicht, mit mehr Leichtigkeit zu leben und zu arbeiten.
Mit Störnarrativen arbeiten
Im Coaching mit P. haben wir genau in diesem Sinne mit dem Narrativ gespielt. Wir haben dann entdeckt, dass in den Aktanten vieler Erzählungen von P. über schwierige Präsentationssituationen einer der Gegenspieler ein „Fremdeln“ mit bestimmten Themen und Inhalten war, die P. meinte, in seine Präsentation aufnehmen zu müssen, ohne voll und ganz dahinterzustehen – zum Beispiel irgendwelche Mission-Statements des Unternehmens, an die er nicht wirklich glauben konnte. Diejenigen Präsentationen, in denen er sich diesen Druck nicht machte, waren besser gelaufen. Ihm fiel dann auch wieder ein, dass er bei dem auslösenden Schul-Erlebnis ebenfalls Inhalte glaubte referieren zu müssen, hinter denen er nicht stehen konnte. Er ging nochmal durch seine Bereichsleiterpräsentation und warf alles raus, was er nur „als Pflicht“ aufgenommen hatte. Die Präsentation lief dann sehr gut für ihn.
Die Arbeit mit Störnarrativen ist ein zentrales, aber nicht das einzige Element der Praxis, die Christine Erlach und ich „In Aktanz gehen“ nennen, und die helfen kann, zu einem leichteren, spielerischen und offenen (Arbeits-)Leben zu gelangen.
Vom 7. bis 9. November 2024 bieten wir in Stuttgart ein dreitägiges Coaching-Seminar an, in dem die Teilnehmer:innen an ihren Störnarrativen im beruflichen Kontext arbeiten können. Gleichzeitig lernen sie dabei Methoden und Werkzeuge kennen, die sie dann selbst als Coaches, Organisationsentwickler oder Führungskräfte anwenden können. Weitere Informationen dazu unter Narratives Management.
Bild von Егор Камелев auf Pixabay


